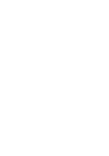Programm mit Texten und CVs als pdf
EN PASSANT LE RHIN
Halldór Bjarki Arnarson Cembalo
Soko Yoshida Barockvioline
Ein Improvisationskonzert, von dem facettenreichen Stil Johann Jakob Frobergers inspiriert, mit Einblicken in die verschiedenen musikalischen Szenerien, die ihm auf seinen Reisen begegneten. Johann Jakob Froberger (1616—1667) spielte eine führende Rolle für die Entwicklung der europäischen Cembalomusik. In Stuttgart aufgewachsen, verlor er mit 21 beide Eltern während des Dreissigjährigen Krieges und zog im selben Jahr nach Rom, um bei Girolamo Frescobaldi Unterricht zu nehmen. Den grössten Teil seiner Karriere verbrachte Froberger in Wien, war aber viel in Deutschland, Flandern, Frankreich und bis nach England unterwegs, um verschiedenste Musiker, Künstler und Diplomaten zu treffen. Seine Bekanntschaften in Frankreich mit berühmten Lautenisten und Cembalisten der Zeit, unter anderem Denis Gaultier und Louis Couperin beeinflussten seine Art, für das Cembalo zu komponieren, stark. Wegen seiner für die damalige Zeit ungewöhnlichen Kenntnis sowohl der italienischen Tastentradition (Gattungen wie Capriccio, Toccata, Ricercare) als auch der französischen (Tanzsuiten, Stil Luthé usw.), ist Froberger noch heute ein spannendes Vorbild als Beherrscher weitreichender Möglichkeiten auf dem Instrument. Seine enge Freundschaft mit Matthias Weckmann baute weiterhin eine Brücke zur norddeutschen Orgeltradition. Im folgenden Programm wird die*der Zuhörer*in auf Frobergers Reisen durch die Nationalstile mitgenommen, um zu erfahren, wie ihn die verschiedenen Ästhetiken beeinflusst haben könnten. Bei jeder Station wird ein Blick in die musikalische Praxis der jeweiligen Nation geworfen: Zuerst eine Komposition der jeweiligen Zeit, darauf folgt unmittelbar eine Cembalo- Improvisation, die Elemente aus demselben Stil einbindet, jedoch Frobergers Kompositionsstil treu bleibt. Die Möglichkeit, die Improvisationspraxis live zu erleben, ermöglicht dem Publikum, der Gedankenwelt des wandernden Komponisten ein Stückchen näher zu kommen, denn die Bearbeitung verschiedener Elemente und Umwandlung deren in neues musikalisches Output wird auf eine spannende Weise in der Luft begreifbar. In der Mitte des Programms steht ein kleiner Tanzsatz von Froberger selbst, der in einem Berliner Manuskript mit dem Titel Allemande faite en passant le Rhin erscheint. Es ist ein programmatisches Stück, zu dem ein ausführlicher Text gehört, der mithilfe Nummerierungen die Allemande Abschnitt für Abschnitt erklärt. Der Text handelt davon, wie einst ein Gefährte von Froberger an einer gefährlichen Stelle im Rhein über Bord fiel, und die darauf folgenden zahlreichen Rettungsversuche. Der zentrale Platz von Frobergers Allemande im Programm steht für die Idee, dass seine Reisen und seine musikalische Entwicklung Hand in Hand gehen. Aldebrando Subissati war ein Zeitgenosse Frobergers in Rom, der später nach Polen übersiedelte, um am königlichen Hofe Johanns II. Kasimir zu arbeiten. Die Sonata seconda stammt aus seiner Hauptquelle, einem Manuskript von 19 Geigensonaten, und ist in Form einer italienischen Canzona komponiert. In Frankreich dominierte zu dieser Zeit die Gattung Air de Cour, kurze Säkularlieder, hauptsächlich für eine Singstimme und ein begleitendes Zupfinstrument, typischerweise die Laute. Es werden zwei Air de Cours von Sebastien Le Camus in einer instrumentalen Fassung erklingen, als Eindrücke der französischen Ästhetik. Der Geigenvirtuose Nicola Matteis unternahm etwa 40 Jahre später als Froberger ebenfalls eine Europareise, und zwar von Italien nach London. Seine Kompositionen verbinden ebenfalls den französischen und italienischen Stil und lassen den gemischten Stil des Hochbarocks vorausahnen.
Halldór Bjarki Arnarson
Programm
Improvisation
Toccata a due
Aldebrando Subissati
Sonata seconda
aus: Il primo libro delle sonate di violino del Signor Aldebrando Subissati sonator famosissimo 1675
Improvisation
Toccata
Improvisation
Diverse partite sopra
Wie schön leuchtet der MorgensternImprovisation Ricercare und Fantasia über den selben Choral
Johann Jakob Froberger
Allemande faite en passant le Rhin
aus: Handschrift SA4450, Staatsbibliothek zu Berlin
Sébastien Le Camus
Forests, linux écartez
Que les jaloux transports
Improvisation
Suite in D-Dur
Nicola Matteis
Auslese von Ayrs und Tänzen für Violine und Cembalo: Proludio — Adagio and Presto — Adagio — Giga — Fuga
aus: Ayres For the Violin… erster und dritter Teil, 1676 & 1685
Komponisten
Aldebrando Subissati 1606–1677
Johann Jakob Froberger 1616–1667
Sébastien Le Camus ca. 1610–1677
Nicola Matteis ca. 1650–unbekannt
Das waren die Konzerte 2024
Programmbroschüre zum herunterladen | Plakat A3 zum herunterladen
Festtage Alte Musik 2024
19. – 21. April 2024
Vanitas vanitatum
vom Barock ins 21. Jahrhundert
Freitag, 19. 4. 2024, 18 Uhr, Klingental, Kleines Refektorium, 1. Stock
Vortrag Dr. Gian Casper Bott
Glücksrad, Totentanz und Vanitas –
Musik als Zeitmetapher in der abendländischen Malerei.
Umrahmende Musik von Jacob van Eyck
mit Mira Gloor, Blockflöte
Eintritt frei, Kollekte
Freitag, 19. 4. 2024, 19.30 Uhr, Klingental, Grosses Refektorium
Vanitas vanitatum
Werke von Robert Schumann und Frédéric Chopin
Christophe Coin, Violoncello, und Akiko Ebi, Fortepiano
Eintritt: CHF 35, Studierende CHF 20
Vorverkauf: Ticketcorner
Samstag, 20. 4. 2024, 18 Uhr, Klingental, Grosses Refektorium
Es gibt kein Festhalten
Lukas Langlotz
«Als wäre es», 6 Lieder für Bassbariton und Streichquartett über Texte von
Andreas Gryphius und Fernando Pessoa
Uraufführung (Kompositionsauftrag der Festtage)
Eintritt frei, Kollekte
Franz Schubert
Drei Lieder und Streichquartett Nr. 14, d-moll,
Der Tod und das Mädchen
Dominik Wörner, Bariton, und Streichquartet
Eintritt frei, Kollekte
Sonntag, 21. 4. 2024, 11 Uhr, Wildt’sches Haus am Petersplatz
Musik und Lyrik aus dem Dreissigjährigen Krieg
Werke von Erlebach, Selle, Staden u.a.
Capricornus Consort Basel
Markus Jans, Rezitation
Eintritt frei, Kollekte
17 Uhr, Musik-Akademie, Grosser Saal
Concerti und Opern-Arien von Antonio Vivaldi
Dominik Wörner, Bariton und Miho Fukui, Barockfagott
Ensemble F
Eintritt: CHF 35, Studierende CHF 20
Vorverkauf: Ticketcorner
Festtage Alte Musik 2024
19. – 21. April 2024
Vanitas vanitatum
vom Barock ins 21. Jahrhundert
Freitag, 19. 4. 2024, 18 Uhr, Klingental, Kleines Refektorium, 1. Stock
Vortrag Dr. Gian Casper Bott
Glücksrad, Totentanz und Vanitas –
Musik als Zeitmetapher in der abendländischen Malerei.
Umrahmende Musik von Jacob van Eyck
mit Mira Gloor, Blockflöte
Eintritt frei, Kollekte
Freitag, 19. 4. 2024, 19.30 Uhr, Klingental, Grosses Refektorium
Vanitas vanitatum
Werke von Robert Schumann und Frédéric Chopin
Christophe Coin, Violoncello, und Akiko Ebi, Fortepiano
Eintritt: CHF 35, Studierende CHF 20
Vorverkauf: Ticketcorner
Samstag, 20. 4. 2024, 18 Uhr, Klingental, Grosses Refektorium
Es gibt kein Festhalten
Lukas Langlotz
«Als wäre es», 6 Lieder für Bassbariton und Streichquartett über Texte von
Andreas Gryphius und Fernando Pessoa
Uraufführung (Kompositionsauftrag der Festtage)
Eintritt frei, Kollekte
Franz Schubert
Drei Lieder und Streichquartett Nr. 14, d-moll,
Der Tod und das Mädchen
Dominik Wörner, Bariton, und Streichquartet
Eintritt frei, Kollekte
Sonntag, 21. 4. 2024, 11 Uhr, Wildt’sches Haus am Petersplatz
Musik und Lyrik aus dem Dreissigjährigen Krieg
Werke von Erlebach, Selle, Staden u.a.
Capricornus Consort Basel
Markus Jans, Rezitation
Eintritt frei, Kollekte
17 Uhr, Musik-Akademie, Grosser Saal
Concerti und Opern-Arien von Antonio Vivaldi
Dominik Wörner, Bariton und Miho Fukui, Barockfagott
Ensemble F
Eintritt: CHF 35, Studierende CHF 20
Vorverkauf: Ticketcorner
|
KONZERT 1
Konzertreihe – Festtage Alte Musik Mittwoch, 31. Januar 2024, 20 Uhr Wildtsches Haus, Petersplatz Zweierlei zu zweit Mira Gloor – Blockflöte Han-na Lee – Cembalo Programm zum herunterladen Johann Sebastian Bach Nach Triosonate für Orgel Nr. 6, BWV 530 in C-Dur (orig. G-Dur) (1685–1750) Vivace – Lente – Allegro Asger Lund Christiansen Sonatina op. 15 Nr. 1 für Sopranblockflöte und Cembalo (1927–1998) Allegro vivace – Cadenza/Andante quasi Allegretto/Cadenza – Allegro vivace – Presto scherzando Johann Sebastian Bach Nach Suite für Laute, BWV 997 in d-Moll (orig. c-Moll) Preludio – Fuga – Sarabanda – Giga/Double Gordon Jacob Sonatina für Altblockflöte und Cembalo (1895–1984) Allegro – Tempo di menuetto – Adagio – Allegro vivace Johann Sebastian Bach Nach Triosonate für Traversflöte, Violine und Basso continuo, BWV 1038 in G-Dur Largo – Adagio – Vivace – Presto Mira Gloor – Blockflöte Han-na Lee – Cembalo Zweierlei zu zweit Im heutigen Programm begegnen sich Blockflöte und Cembalo auf Augenhöhe und erklingen gemeinsam in Alter und Neuer Musik. Den Rahmen bilden Triosonaten und Suiten von Johann Sebastian Bach, die ursprünglich für andere Instrumente und Kombinationen komponiert wurden. Wie zu Bachs Zeit üblich, wurde das Notenmaterial dieser bestehenden Sonaten genommen und für eine neue Besetzung – in unserem Fall für Blockflöte und Cembalo – arrangiert. Im Gegensatz dazu stehen zwei moderne Sonatinen aus dem 20. Jahrhundert, die explizit für diese Besetzung komponiert wurden, einmal für Sopranblockflöte und Cembalo, einmal für Altblockflöte und Cembalo. In der Triosonate für Orgel Nr. 6, BWV 530 werden in der Originalfassung alle drei Stimmen von einem Spieler an der Orgel gespielt. Dies ermöglicht eine einfache Bearbeitung, bei der die Blockflöte eine der Oberstimmen übernimmt, während das Cembalo die beiden anderen Stimmen spielt. Bach selbst hatte seine Orgeltriosonaten zum Teil aus Bearbeitungen instrumentaler Ensembletrios und aus Umarbeitungen älterer Vorlagen zusammengestellt. Johann Nikolaus Forkel schreibt in seinem Buch «Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke» (1802): «Bach hat sie für seinen ältesten Sohn, Wilh. Friedemann, aufgesetzt, welcher sich damit zu dem grossen Orgelspieler vorbereiten musste, der er nachher geworden ist. Man kann von ihrer Schönheit nicht genug sagen. Sie sind in dem reifsten Alter des Verfassers gemacht, und können als das Hauptwerk desselben in dieser Art angesehen werden.» (Forkel 1802, S. 60). Asger Lund Christiansen schrieb seine Sonatina für Sopranblockflöte und Cembalo 1985 für die dänische Blockflötistin Michala Petri und ihre Mutter Hanne Petri (Cembalo). Christiansen war ein dänischer Cellist und Komponist und Professor an der Royal Danish Academy of Music. Von ihm gibt es zahlreiche Kammermusikwerke sowie verschiedene Instrumental- und Orchesterwerke im Stil des Neoklassizismus. In der Sonatina op. 15 Nr. 1 erklingt im zweiten Satz im Lento improvisando als Kadenz das dänische Volkslied «Ebbe Skammelsen». Von Bachs Suite oder Partita BWV 997 gibt es zwei Fassungen, von denen aber kein Manuskript erhalten ist. Die erste Fassung, die zwischen 1738 und 1741 entstand, war wahrscheinlich ursprünglich für das Lautenclavier gedacht. Die zweite Fassung wurde dann für die Laute bearbeitet. Eine der Quellen ist eine Abschrift von Johann Philipp Kirnberger, einem Schüler Bachs, mit dem Titel «Klavier-Sonate von Joh. Sebastian Bach». Eine weitere Abschrift stammt von Carl Philipp Emanuel Bach und trägt den Titel «C moll Praeludium, Fuge, Sarabande und Gigue für Clavier von J.S. Bach». Gordon Jacobs Sonatina für Altblockflöte und Cembalo wurde 1983 ebenfalls für die Blockflötistin Michala Petri komponiert. Der englische Komponist war Professor am Royal College of Music in London. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher und Artikel über Musik, komponierte über 700 Werke und arrangierte Werke anderer Komponisten. Sein erstes Werk für Blockflöte war die erfolgreiche Suite für Blockflöte und Orchester, die von Carl Dolmetsch in Auftrag gegeben wurde. Nach einem Besuch bei Gordon Jacob schrieb Michala Petri: «Ich besuchte ihn in Saffron Walden, einer wunderschönen kleinen Stadt, in der er mit seiner Frau Margaret lebte. Er war damals schon sehr alt und ein unglaublich freundlicher Mann, mit einer sehr positiven, ruhigen und beruhigenden Art. Ich ging vor allem deshalb zu ihm, um seine Meinung darüber einzuholen, wie ich seine Suite spielte, die ich mit der Academy of St. Martin in the Fields aufnehmen sollte. Nachdem ich ihm die Suite vorgespielt hatte, fragte ich ihn, ob er vielleicht etwas für mich schreiben könnte, das ich mit dem Cembalo spielen könnte». (CD-Booklet «UK DK», OUR Recordings, S. 11) Die Triosonate für Traversflöte, (skordierte) Violine und Basso continuo BWV 1038 gibt einige Rätsel auf. Bachs Autorenschaft wird aus stilistischen Gründen teilweise angezweifelt, obwohl die Stimmen der Hauptquelle Bachs Handschrift tragen. Leider hat Bach aber vergessen, oder vielleicht hielt er es auch nicht für nötig, seinen Namen hinzuzufügen. Die Triosonate steht in engem Zusammenhang mit den beiden Violinsonaten BWV 1021 und BWV 1022, die alle drei auf demselben Bass basieren. So ist die Violinsonate in G-Dur BWV 1021 die erste Sonate mit diesem Bass und kann mit Sicherheit J.S. Bach zugeschrieben werden. Die Sonate in F für obligates Cembalo und skordierte Violine, BWV 1022, entspricht weitgehend der Fassung in G für Traversflöte, (skordierte) Violine und Basso continuo, BWV 1038. In der heute gespielten Fassung übernimmt die Blockflöte den Part der Traversflöte, das Cembalo den Part der Violine und den Basso continuo. |
Han-Na Lee
Han-Na Lee wurde in Seoul geboren. Ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie im Alter von vier Jahren. Von 1999 bis 2003 studierte sie Klavier am Presbyterian College and Theological Seminary in Seoul und schloss ihr Studium mit dem Bachelor of Music (Klavier) mit Auszeichnung ab. Von 2003 bis 2005 studierte sie Cembalo an der Korean National University of Arts (Master of Arts). Ab 2005 studierte sie Cembalo bei Andrea Marcon an der Schola Cantorum Basiliensis und schloss 2009 mit Auszeichnung ab (Diplom für Alte Musik). Im Jahr 2011 absolvierte sie den Masterstudiengang Spezialisierte Historische Aufführungspraxis an der Schola Cantorum Basiliensis bei Jörg-Andreas Bötticher. 2018 schloss sie ihr Meisterklassenstudium bei Nicolas Parle an der Hochschule für Musik und Theater ‹Felix Mendelssohn Bartholdy› Leipzig mit Auszeichnung ab. Sie war erste Preisträgerin des Seoul Symphony Orchestra Wettbewerbs (2004) und zweite Preisträgerin des 31. Masterplayers International Music Competition (2011). Im Jahr 2019 wurde sie erste Preisträgerin des Wanda Landowska Wettbewerbs für Cembalo und Orchester und zweite Preisträgerin des Wanda Landowska Preises. Seit 2006 arbeitet sie als Korrepetitorin für Cembalo an der Hochschule für Musik Basel und seit 2010 an der Schola Cantorum Basiliensis, Musikschule der SCB, Konservatorium Freiburg. Mira Gloor Mira Gloor wurde in Basel geboren und erhielt ihren ersten Blockflötenunterricht im Alter von vier Jahren. Von 2009 bis 2012 studierte sie an der Schola Cantorum Basiliensis bei Conrad Steinmann. Im Sommer 2012 schloss sie da ihr Bachelorstudium mit Auszeichnung ab. Sie setzte ihr Studium bei Pedro Memelsdorff in Barcelona an der Escola Superior de Música de Catalunya fort, wo sie im Sommer 2013 den «Màster de Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga» ebenfalls mit Auszeichnung abschloss. Für den Master in Musikpädagogik kehrte sie an die Schola Cantorum Basiliensis zurück und schloss ihr Studium bei Conrad Steinmann und Katharina Bopp im Sommer 2015 sowohl im künstlerischen als auch im pädagogischen Fach mit Auszeichnung ab. Ihr Repertoire reicht von der mittelalterlichen bis zur zeitgenössischen Musik und sie konnte ihre Kenntnisse in zahlreichen Meisterkursen u.a. bei Nikolaj Ronimus, Han Tol, Dan Laurin und Peter Van Heyghen sowie bei verschiedenen Soloauftritten mit Orchester stetig erweitern. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit ist sie auch als Musikpädagogin tätig. Sie ist Mitbegründerin und Mitglied des Ensemble Matís und des Consort Tourterelles, mit denen sie regelmässig Konzertprogramme erarbeitet und in ganz Europa, Israel und Südkorea aufführt. Mit dem Ensemble Matís gewann sie im März 2013 den zweiten Preis beim Internationalen Telemann- Wettbewerb in Magdeburg und nahm zwei CDs auf: «Vanitas – Chamber music from the early baroque» und «André Cheron – Sonatas from the French Baroque», die 2017 und 2018 bei ARS Produktion erschienen sind. |
Das waren die Konzerte 2023
|
Programm als pdf zum herunterladen Konzertreihe – Festtage Alte Musik | Konzert 4 | Saison 2023 Mittwoch, 6. Dezember 2023, 20 Uhr Kulturkirche Paulus, Steinenring 20, Basel Miserere «Französische Polyphonien für Frauenstimmen in Abteien des 17. Jahrhunderts» Ensemble Correspondances Sébastian Daucé, Leitung Programm Marc-Antoine Charpentier (1643–1704) Sub tuum praesidium Guillaume Nivers (ca1632–1714) Prélude Plaint chant Hodie Maria Virgo Marc-Antoine Charpentier Ave regina caelorum H.19 Antoine Boesset (1587–1643) Anna Mater matris Ave mater pia Sancta maria Guillaume Nivers O Admirabile commercium Paolo Lorenzani (1640–1713) O quam suavis est Henry Dumont (1610–1684) Desidero te millies Ave regina caelorum François Couperin (1668–1733 Fantaisie pour les violes) Plaint chant De Profundis Nicolas Clérambault (1676–1749) Miserere Besetzung Sopran Caroline Weynants Sopran Caroline Bardot Sopran Marie-Frédérique Girod Sopran Eva Plouvier Mezzosopran Marie Pouchelon Mezzosopran Mathilde Ortscheidt Gambe Etienne Floutier Fagott Mélanie Flahaut Theorbe Thibaut Roussel Orgel, Leitung Sébastien Daucé Zum Programm La voix des Anges – Engelsstimmen Im Zuge einer neuen Frömmigkeit und der Gegenreform, entstehen im Paris des 17. Jahrhunderts zahlreiche Nonnenkonvente. Am Übergang zum 18. Jahrhundert zählt man nicht weniger als 600 allein innerhalb der Stadtmauern! Sie fungieren als Orte des Gebets, manchmal als Krankenhäuser, Hospize, Orte der Barmherzigkeit und des Rückzugs für Frauen (vor für allem jene, die ihre Ehemänner verlassen haben) oder auch als Bildungseinrichtungen für Mädchen: Die Schulen sind noch ausschließlich den Jungen vorbehalten. Jeder Konvent folgt einer Kongregation oder einem Orden mit einer bestimmten sogenannten Regel: Diese bestimmt die zeitliche und räumliche Organisation des Alltags der Nonnen und allen, die innerhalb der Klostermauern leben und arbeiten. So bestimmt die Regel auch, welche Rolle der Musik zukommen soll: Diese Rolle variiert also von einem Ort zum anderen. Zwei weitere Faktoren können ausserdem die musikalische Praxis in den Konventen beeinflussen: Die finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen (Musik war damals schon sehr teuer!) und der persönliche Geschmack der Oberin. Mehrere Beispiele zeigen, wie die Äbtissin ihre ganz eigene Interpretation der Regel anwendet, um Platz für ihre bevorzugte Musik zu schaffen… In den meisten der 600 Pariser Konvente erklingt so regelmäßig Musik: zunächst (und häufig ausschliesslich) in Form von gregorianischen Gesängen, der Wurzel geistlich-christlicher Vokalmusik. Tatsächlich stammen diese Gesänge jedoch nicht immer aus den Anfängen der christlichen Kultur, sondern werden teils für einen spezifischen Ort neu geschrieben und gehören so zu den spezifischen Charakteristika eines bestimmen Zeremoniells. Ähnlich wie am Hofe Ludwigs XIV., und doch ganz anders, zeigt die Musik so Macht und Unabhängigkeit. Im Falle mancher besonders wohlhabender Konvente, kommt der Musik eine bevorzugte Rolle zu. Hier werden auskomponierte Vokalmusik (d.h. Motteten und nicht ausschließlich Monodien) und Instrumente von den Nonnen und jungen Frauen zum klingen gebracht. So beispielsweise in der Königlichen Abtei von Montmartre, wo zur Mitte des 17. Jahrhunderts die Nonnen singen und sich auf diversen Instrumenten (Orgel, Gambe, Laute) selbst begleiten. Antoine Boesset war hier der, von den Nonnen - so sagt man – viel geliebte, Organist und Leiter der musikalischen Aktivitäten. Dieser grosse Komponist der Regentschaft Ludwigs des XIII., bekannt für seine Airs de cour und seine Ballette, dessen Melodien von den Salons der Oberschicht bis in die Strasse überall zu hören waren, schreibt also für die Damen von Montmartre ein gänzlich originelles Repertoire von Polyphonien für mehrere Stimmen gleicher Tonlage. Dieses Repertoire zeigt auch wie meisterhaft Boesset mit Harmonie und Kontrapunkt umzugehen weiss, um eine ganz wunderbare Musik zu schaffen, die so anders daher kommt als seine bekannten Lieder und Airs. Etwas später im gleichen Jahrhundert gründet Madame de Maintenon, zweite (morganatische) Ehefrau Ludwigs XIV, eine religiöse Einrichtung für Mädchen des verarmten Adels. Die Musik nimmt hier einen zentralen Platz ein und die grössten Komponisten geistlichen Repertoires ihrer Zeit werden engagiert: Gabriel Nivers und Nicolas Clérambault. Sie schreiben eine Musik von immenser Tiefe, wobei sie jedoch manchmal die individuellen Qualitäten einzelner Sängerinnen über eine natürliche Zurückhaltung, wie sie die die Schutzherrin des Konvents erwartet, hinaus nutzen. Durch solch grenzüberschreitende Sinnlichkeit, verschwindet die Musik bald: Sie gilt als zu subversiv! Diese Frauenstimmen bleiben bis heute von Geheimnissen und Legenden umgeben. Die Frauenkonvente, wie sie von den wenigen privilegierten Zuhörern beschrieben werden, verbinden Exzellenz und Unzugänglichkeit: Der Zugang zum Chor war streng verboten und ohne sehen zu können, wer diese Klänge hervorbringt, hatten die wenigen Besucher den Eindruck im Paradis zu sein, umgeben von musizierenden Engeln. Der Gesang der Frauen erhebt, wie schon damals, die Sinne der Zuhörer und berührt die Seele… |
©Alban van Wassenhove
Zum Ensemble
Seit seiner Gründung 2009 vereint Correspondances unter der Direktion des Cembalisten und Organisten Sébastien Daucé eine Gruppe von Sängern und Instrumentalisten, allesamt Spezialisten der Musik des Grand Siècle. In nur wenigen Jahren ist das Ensemble eine Referenz auf dem Bereich des französischen Repertoires des 17. Jahrhunderts geworden, und interpretiert diese Musik von auch heute berührender Klanglichkeit, in teils seltenen und originellen Formaten. Im Zentrum der Arbeit des Ensembles stehen dabei die Wiederentdeckung ungespielter Werke und die Ausdrucksformen eines an den Praktiken des 17. Jahrhunderts orientierten Spiels. Durch langangelegte Forschungsprogramme entstanden bewegende Ergebnisse wie die monumentale Rekonstruktion der Krönungsmusiken Ludwigs XIV. (Le Sacre de Louis XIV) oder des Königlichen Nachtballets, jenes zentralen musikalischen Moments des 17. Jahrhunderts, der die Herrschaft des Sonnenkönigs einläutete (Le Ballet Royal de la Nuit). Dem Ensemble ist es wichtig, sowohl bekannteren Komponisten neues Leben einzuhauchen, als auch bereits vergessene Musiker der Vergangenheit neu zu betrachten. So sind bisher Achtzehn Aufnahmen bei dem Label hamonia mundi entstanden, allesamt von der französischen und der internationalen Kritik ausgezeichnet. Zu erwähnen sind: Die Litanies de la Vierge (2023), die Pastorale de Noel (2016) und die Histoires Sacrées (2019) des bevorzugten Komponisten des Ensembles, Marc-Antoine Charpentier; Étienne Mouliniés Meslanges pour la Chapelle d’un Prince; die Grossen Motetten von Henry du Mont (2016) und Michel-Richard de Lalande (2022); Lucile Richardots erstes Soloalbum Perpetual Night (2018); das Membra Jesu Nostri von Buxtehude (2021), sowie Matthew Lockes Psyche (2022). Mit diesem Sinn für Erforschung und Wiederentdeckung widmet sich Correspondances auch der lyrischen Bühnenkunst, die der modernen Oper vorausging. So liegt es dem Ensemble am Herzen, szenische Formate aus Frankreich und anderswo, wie das Ballet de Cour, die Histoire Sacrée, die Halb-Oper oder die englische Mask, wiederzubeleben. 2017 entsteht das Ballet Royal de la Nuit, mit seiner grossartigen und märchenhaften Choreografie im Sinne des 21. Jahrhunderts von Francesca Lattuada, am Theater Caen. Mit dem Stück Songs, inszeniert von Samuel Achache für die Stimme von Lucile Richardot oder der englischen Mask Cupid & Death, einem exzentrischen Divertimento in einer Welt, die gänzlich auf dem Kopf zu stehen scheint, erdacht von Jos Houben und Emily Wilson am Theater Caen 2021, setzt das Ensemble seine Erkundungen jener experimentellen Formate fort, die das 17. Und 18. Jahrhundert geprägt haben. Ebenfalls 2021 spielt Correspondances zum ersten Mal beim Festival Lyrique d’Aix-en Provence mit seinem Combattimento, die Theorie des schwarzen Schwans, einer utopischen Bühnenkomposition von Silvia Costa, um die Rekonstruktion der Idealstadt auf der Grundlage von Werken Monteverdis und seiner italienischen Zeitgenossen des Anfangs des 17. Jahrhunderts. Auf gänzlich unkonventionellen Pfaden, bringt Correspondances Polyphonie und Lyrik dorthin, wo man sie nicht erwarten würde: Seit 2020 zieht das Ensemble jeden Sommer mit dem Fahrrad durch die Lande und lässt die Musik des 17. Jahrhunderts in den Dörfern der Normandie erklingen. Ein musikalisches und sportliches Abenteurer für Gross und Klein. https://www.ensemblecorrespondances.com/ |
|
Programm als pdf zum herunterladen
Konzert 3 | Konzertreihe – Festtage Alte Musik Mittwoch, 11. Oktober 2023 Predigerkirche, Basel 20 Uhr Cum Sancto Spiritu Marian Polin Stücke für Orgel von Antonio de Cabezón, Jehan Titelouze, Nicolas de Grigny, Johann Sebastian Bach Eintritt frei, Kollekte CUM SANCTO SPIRITU Antonio de Cabezón (1510–1566) Tiento Sobre Cum Sancto Spiritu (nach Josquin Desprez) Aus: «Obras de música para tecla, arpa y vihuela» (Madrid, 1578) Jehan Titelouze (1563–1633) Veni Creator Spiritus Verset 1 – Choralis in Basso Verset 2 – Choralis in Canto Verset 3 – Canon in Diapason Verset 4 – à 4 Nicolas de Grigny (1672–1703) Veni Creator Spiritus 1. Veni Creator en taille à 5 (Plein jeu) 2. Fugue à 5 3. Duo 4. Récit de Cromorne 5. Dialogue sur le grands jeux Aus: «Livre d’orgue» (Paris,1701) Johann Sebastian Bach (1685–1750) Komm, Heiliger Geist, Herre Gott alio modo à 2 Clav. e Pedale BWV 652 Aus: «18 Leipziger Choräle» Piece d’Orgue BWV 572 Zum Programm Das heutige Orgelkonzert auf ist stilistisch von den beiden Orgeln der Predigerkirche inspiriert: der Schwalbennest-Orgel im Stil der Frührenaissance (Bernhard Edskes, 1985) und der Hauptorgel (Andreas Silbermann, 1767; rekonstruiert von Metzler Orgelbau 1978). Diese bieten die klangliche Basis, um anhand von Kompositionen zum Thema «Heiliger Geist» eine Entwicklungslinie von der spanischen Hochrenaissance über den frankoflämischen bis hin zur Adaptierung des ikonischen französischen Barockstils auf die Orgel, sowie dessen Rezeption durch J. S. Bach. Der blinde Organist Antonio de Cabezòn (ca. 1510–1566) wurde im Alter von 16 Jahren Organist der Kaiserin Isabella, einer Zeit, als die kaiserliche Kapelle Karls des V. unter der Leitung des berühmten Nicolas Gombert stand. Er sollte sein Leben lang in habsburgischen Diensten bleiben und mehrere Reisen, unter anderem nach Deutschland und Österreich, unternehmen. 1578 erschien posthum sein Hauptwerk «Obras de música para tecla, arpa, y vihuela», in dem unter anderem 12 sogenannte «Tientos» (zu Deutsch etwa «Versuche») enthalten sind, welche von der polyphonen Motette inspirierte Instrumentalstücke darstellen. Einige davon gehen direkt auf ältere Meister zurück, so ist der «Tiento sobre Cum sancto Spiritu» eine klare Reminiszenz an den berühmten Josquin des Prez und paraphrasiert einen Abschnitt seiner «Missa de Beata Vergine». Jehan Titelouze (1563–1633) war Organist an der Kathedrale von Rouen und gilt als Begründer der französischen Orgelmusik, indem er sowohl in der Komposition als auch im Orgelbau erstmals gewisse bleibende Standards definierte. Sein Werk steht an der Schwelle zwischen Renaissance und Barock. Sein Hauptwerk «Hymnes de l›Église pour toucher sur l›orgue, avec les fugues et recherches sur leur plainchant» (1623) enthält auch den Pfingsthymnus «Veni Creator Spiritus», welcher traditionell in der Vesper der Pfingstoktav seinen Platz hat. Für die Alternatim-Praxis vertonte er 4 der 7 Strophen auf unterschiedliche Weise, indem der Cantus Firmus unverziert und in grossen Notenwerten zuerst im Bass, Cantus und Tenor verarbeitet, bevor dieser im letzten Teil im alten Stil imitatorisch verarbeitet wird. Die Musik von Titelouze ist im weitesten Sinne als «kontinental» zu betrachten und noch weit entfernt von dem, was wir heute als «französisch barock» bezeichnen. Bis zur Prachtentfaltung von Versailles und der Definition des charakteristischen französischen Barockstils (vor allem durch die beherrschende Figur des «Surintendant de la musique du Roy», Jean Baptiste Lully) sollte noch ein gutes Vierteljahrhundert ins Land ziehen. Jener Stil begann sich alsbald auch in der Orgelmusik niederzuschlagen und wurde mit den althergebrachten Techniken der Cantus Firmus-Bearbeitung verbunden. Der junge Nicolas de Grigny (1672–1703), der fast zeitlebens an der Kathedrale von Reims Organist war, wurde sehr geprägt von Guillaume Nivers, dem Organisten der «Chapelle royale» in Versailles. In seinem «Livre d’orgue» (Paris, 1699) präsentiert er neben Orgelmessen auch Hymnen für den alternatim-Gebrauch, darunter das fünfsätzige «Veni Creator». Der erste Satz (Plein Jeu) führt den Cantus firmus pedaliter streng «en taille» (im Tenor) durch, wogegen sich die folgenden vier Sätze «Fugue à cinq», «Duo», «Récit de Cromorne» und «Dialogue sur les grands jeux» keine Choral-Durchführungen im engeren Sinne darstellen, sondern leiten nur das Kopfmotiv und einzelne melodische Elemente aus dem Cantus Firmus ab. Es handelt sich für sich genommen um Miniaturen, die bei einer Alternatim-Afführung zwar den Duktus und die modale Färbung des wiederkehrenden Chorals bewahren, aber eher orchestrale Aspekte wie Oboen-Consorts oder den Wechsel zwischen verschieden Holzbläsern imitieren. De Grignys Orgelbuch wäre nicht zuletzt von solcher Bedeutung, wäre es nicht vom jungen Johann Sebastian Bach (1685–1750) abgeschrieben worden, wahrscheinlich als er als Lateinschüler 1700–1702 in Lüneburg weilte. In einigen von Bachs Choralvorspielen, besonders jenen mit koloriertem Diskant oder Cantus Firmus im Tenor, erahnt man durchaus den französischen Einfluss. Gerade im 3. Teil der Clavierübung offenbart sich der gereifte Bach noch einmal als «Franzose im Herzen», etwa in dem er klassische Formen wie etwa «Tierce en taille» oder wiedererkennbare Tänzrhythmen mit den Techniken der Choralbearbeitung verbindet. Das Choralvorspiel «Komm Heiliger Geist, Herre Gott» verarbeitet auf kunstvolle Weise das gleichnamige Luther-Lied, das wiederum auf die gregorianische Antiphon zum Magnificat der Pfingst-Vesper («Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium»), zurückgeht. Bach schreibt hier eines seiner am grössten angelegten Choralvorspiele, indem er der Vorimitation der 9 Melodieeinsätze auffallend grossen Raum gibt und dem Stück damit eine fast überirdische Ruhe verleiht. Der bedächtige Schritt einer Sarabande sowie die zahlreichen Verzierungen erzeugen innerhalb weniger Takte einen Hauch von französischer «Grandeur». Zum Thema heiliger Geist hat Bach naturgemäss viel komponiert, jedoch ist eines der «pfingstlichsten» Stücke die Fantasie in G-Dur, auch genannt «Piece d’Orgue». Die Tonart G-Dur ist nach Charpentier «süss und freudig», in der sich bei Bach Stücke im Dreiertakt häufen. Diese wiederum weissen schon durch ihre Struktur auf den Heiligen Geist, die «Dritte Person» hin, was sich hier durch eine insgesamt dreiteilige Anlage nochmals verstärkt. So beginnt das Stück mit heiterem Laufwerk im 12/8 (also 4x3), das den Hörer etwa an das Flattern einer Taube (Symbol für den Heiligen Geist) erinnern mag, geht dann in einen grandiosen Mittelteil über, in dem Bach einen fünfstimmigen Satz in bester französischer Manier mit nicht enden wollenden Sept- und Nonvorhalten anreichert und damit eine, selbst für seine Massstäbe, unerhörte Feierlichkeit entfaltet. Diese scheinbar nicht enden wollende Himmelslust reisst abrupt mit einem verminderten Septakkord ab und lässt den Zuhörern den Atem stocken, bevor er im 3. Teil (Hl. Geist) durch noch waghalsigeres Laufwerk harmonisch gehörig in die Irre geführt wird. In den kleinen Figuren mit 2x3 32stel-Noten mag man unschwer die Feuerzungen des Heiligen Geistes erkennen, unter die sich nach langem Pulsieren des Pedals schliesslich der erlösende Orgelpunkt einstellt und unmissverständlich auf den Heimathafen G-Dur verweist. Nachdem von diesem Stück kein Autograph erhalten ist, herrscht über dessen Entstehung seit jeher eine Diskussion. Die Handschrift von J. G. Walther stammt von frühestens 1717 und beschränkt den Pedalgebrauch auf wenige Töne, während B. C. Kayer 1722 für den Mittelteil «Pedalle continu» vorschreibt. Bis auf den Orgelpunkt ist das Stück gänzlich manualiter ausführbar, was möglicherweise auf das Cembalo verweist. Das in T. 94 verlangte und aus organistischer Sicht enigmatische Kontra-H ist auf besaiteten Tasteninstrumenten ebenso häufiger vorzufinden als auf Orgeln. Marian Polin |

Marian Polin ist Dozent für Kirchenmusik am Konservatorium «Claudio Monteverdi» in Bozen/Südtirol (I), künstlerischer Leiter des OrgelKunst-Festivals Vinschgau-Meran sowie des Ensembles für Alte Musik «La florida Capella». 2021 initiierte er die Konzertreihe «Innsbrucker Hofmusik» mit, welche sich vor allem dem habsburgischen Repertoire des 16. bis 18. Jahrhunderts widmet und deren Leiter er ist.
Polin studierte Kirchenmusik, Orgel, Generalbass/Cembalo in Wien, Linz, Freiburg/Fribourg und Basel; zu seinen prägendsten Lehrern zählen Maurizio Croci, Jörg-Andreas Bötticher, Wolfgang Glüxam, Brett Leighton und Pier Damiano Peretti. Als Solist, Ensembleleiter und Continuospieler ist er regelmässig zu Gast bei internationalen Festivals, darunter Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, Festival Musik & Kirche Brixen, Tage Alter Musik in Herne, VielKlang Festival Tübingen, «I Tesori d’Orfeo» Pavia, Stockholm Early Music Festival, Orgelfestival Freiburg/Fribourg, Orgelfestival Braga, Orgelfestival «Organy Srebrnego Miasta» Olkusz, Organi storici in Cadore, Bozner Orgelsommer. Für seine Arbeit wurde Polin mit mehreren Preisen ausgezeichnet: 3. Preis beim «Grand Prix d’Echo (Treviso, 2017); H. I. F. Biber-Preis für Alte Musik (St. Florian, 2021); 1. Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb «Daniel Herz» (Brixen, 2022). Weiters war er Stipendiat der «Fondation Académie d’Orgue Fribourg/Freiburg» und erhielt den «Prix d‘excellence» für seine wissenschaftliche Abschlussarbeit an der Haute École de Musique Lausanne. Seine Beschäftigung mit Alter Musik wird durch eine Reihe von CD- und Videoeinspielungen dokumentiert, darunter (Erst-)Einspielungen von Faitelli, Legrenzi, Piscator, Cazzati oder als jüngste Projekte die «Sacri musicali affetti» von Barbara Strozzi (F. Fiorio/La florida Capella) sowie die Marienvesper von Claudio Monteverdi u.a. an der Ebert-Orgel von 1558 (Ensemble der Innsbrucker Hofmusik/YouTube-Kanal «Südtirol in concert»). |
|
Programm als pdf
Plakat als pdf Konzert 2 | Konzertreihe – Festtage Alte Musik Mittwoch, 30. August 2023 Peterskirche, Basel 20 Uhr Pirame et Tisbé Französische Kantaten von Louis-Nicolas Clérambault (1676–1749) a nocte temporis Reinoud Van Mechelen, Countertenor, Leitung Anna Besson, Barockflöte Joanna Huszcza, Barockvioline Loris Barrucand, Cembalo Myriam Rignol, Viola da gamba Eintritt frei, Kollekte Programm Louis-Nicolas Clérambault (1676–1749) Françoises Mellées de Simphonies Kantaten. Buch III. Paris, 1716. Apollon Kantate über den Frieden, für Solostimme und Symphonie Françoises à I. et II. Voix Cantatas. Mit und ohne Sinfonie. Buch I. Paris, 1710. Le Jaloux Zweite Kantate für Solostimme und Symphonie Françoises Mellées de Simphonies Kantaten. Buch II. Paris, 1713. Pyrame et Thisbé Vierte Kantate für Solostimme und Symphonie |
|
Programm als pdf zum herunterladen
Konzert 1 | Konzertreihe – Festtage Alte Musik
Dienstag, 23. Mai 2023
Wildt’sches Haus, Basel
20 Uhr
Pour le Plaisir du Roi
Hofmusik von Lully, Paisible, Dornel, Bodin de Boismortier und Reinhard Keiser
Ensemble La Petite Écurie
Miriam Jorde Hompanera – Barockoboe
Valerie Colen – Barockoboe
Marc Bonastre Riu – Taille
Giovanni Battista Graziadio – Barockfagott
Philipp Lamprecht – Perkussion
Eintritt frei, Kollekte
La Petite Écurie
La Petite Écurie ist ein international besetztes Ensemble bestehend aus Barockoboen (franz.«Hautbois»), Taille, Barockfagott und historischen Schlaginstrumenten.
Hautboistenensembles waren im späten 17. und 18. Jahrhundert äusserst beliebt. Ausgehend von der «Grande écurie» Ludwigs XIV., in der neben anderen Formationen die meisten seiner Bläser angestellt waren, verbreitete sich die beliebte Oboe samt Hautboistenbande bald im restlichen Europa. Es entstand ein vielseitiges Bläser-Repertoire, welches La Petite Écurie pflegt.
2018 gegründet, stösst La Petite Écurie auf reges Interesse bei Publikum und renommierten Konzertveranstaltern. So musizierte das Ensemble bei den Internationalen Barocktagen in Melk, beim Kammermusikfest Lockenhaus (AT) und auf den Festivals in Urbino (IT) und Valletta (Malta). 2020 wurde das Barockensemble in das European Early Music Network aufgenommen.
Ausserdem lud die Philharmonie Luxembourg das Ensemble ein, Teil eines Theaterstücks für Kinder zu sein.
2021 nahm La Petite Écurie ihr Debut-Album «The Queen’s Favourites» für das Label Arcana (Outhere Music) auf. Weitere Einspielungen sind bereits in Planung.Im August 2022 stellte der Musikjournalist Marcus Stäbler das Ensemble in einer einstündigen Sendung auf NDR Kultur einer breiten Öffentlichkeit vor. Abgesehen von Originalmusik für Hautboistenbande spielt das Ensemble auch erweitertes Repertoire, darunter Traditionals und moderne Musik, welche teilweise für das Ensemble bearbeitet wird.
Demnächst wird das Ensemble bei den Tagen Alter Musik Regensburg und dem BachFest Leipzig auftreten.
Konzert 1 | Konzertreihe – Festtage Alte Musik
Dienstag, 23. Mai 2023
Wildt’sches Haus, Basel
20 Uhr
Pour le Plaisir du Roi
Hofmusik von Lully, Paisible, Dornel, Bodin de Boismortier und Reinhard Keiser
Ensemble La Petite Écurie
Miriam Jorde Hompanera – Barockoboe
Valerie Colen – Barockoboe
Marc Bonastre Riu – Taille
Giovanni Battista Graziadio – Barockfagott
Philipp Lamprecht – Perkussion
Eintritt frei, Kollekte
La Petite Écurie
La Petite Écurie ist ein international besetztes Ensemble bestehend aus Barockoboen (franz.«Hautbois»), Taille, Barockfagott und historischen Schlaginstrumenten.
Hautboistenensembles waren im späten 17. und 18. Jahrhundert äusserst beliebt. Ausgehend von der «Grande écurie» Ludwigs XIV., in der neben anderen Formationen die meisten seiner Bläser angestellt waren, verbreitete sich die beliebte Oboe samt Hautboistenbande bald im restlichen Europa. Es entstand ein vielseitiges Bläser-Repertoire, welches La Petite Écurie pflegt.
2018 gegründet, stösst La Petite Écurie auf reges Interesse bei Publikum und renommierten Konzertveranstaltern. So musizierte das Ensemble bei den Internationalen Barocktagen in Melk, beim Kammermusikfest Lockenhaus (AT) und auf den Festivals in Urbino (IT) und Valletta (Malta). 2020 wurde das Barockensemble in das European Early Music Network aufgenommen.
Ausserdem lud die Philharmonie Luxembourg das Ensemble ein, Teil eines Theaterstücks für Kinder zu sein.
2021 nahm La Petite Écurie ihr Debut-Album «The Queen’s Favourites» für das Label Arcana (Outhere Music) auf. Weitere Einspielungen sind bereits in Planung.Im August 2022 stellte der Musikjournalist Marcus Stäbler das Ensemble in einer einstündigen Sendung auf NDR Kultur einer breiten Öffentlichkeit vor. Abgesehen von Originalmusik für Hautboistenbande spielt das Ensemble auch erweitertes Repertoire, darunter Traditionals und moderne Musik, welche teilweise für das Ensemble bearbeitet wird.
Demnächst wird das Ensemble bei den Tagen Alter Musik Regensburg und dem BachFest Leipzig auftreten.
Konzert in Rahmen der Generalversamlung
Mittwoch 22. März 2023
Wildt’sches Haus, Basel
20 Uhr
Come Farfalla
Unbekannte Madrigale aus Apulien (1582)
Werke von Baseo und Palestrina
Schola Cantorum Barensis
Cristina Fanelli – Cantus
Matteo Pigato – Altus
Roberto Rilievi – Quintus
Riccardo Pisani – Tenor
Michele Dispoto – Bassus
Gilberto Scordari – Leitung
Programm
Francesco Antonio BASEO (fl. 1573–1582)
I. Quercia superba e lieta (prima parte)
II. Da’ tuoi dorati rami (seconda parte)
III. L’arme tue furon gl’occhi (prima parte)
IV. L’angelica sembianza (seconda parte)
V. Fuggi ‘l sereno e ‘l verde
XIX. Se ben non veggon gl’occhi
Giannetto da PALESTRINA (1525–1594)
Io son ferito ahi lasso
Version aus F.A. Baseo, Primo libro (1573)
Francesco Antonio BASEO
XI. Come farfalla (prima parte)
XII. E d’appressarmi tremo (seconda parte)
XIII. Forz’è ch’io trovi (prima parte)
XIV. Muse beate (seconda parte)
XX. Se mai colpo d’amor
XXI. Basciami vita mia
Zum Programm
Die unbekannte Gestalt des aus Lecce stammenden Komponisten Francesco Antonio Baseo steht im Mittelpunkt einer Epoche – der letzten dreissig Jahre des 16. Jahrhunderts –, die in dem südöstlichen Teil des Königreichs Neapel, der Terra d›Otranto, von grossem kulturellen Eifer geprägt war. Von Baseo sind drei Sammlungen im Druck überliefert, die alle in Venedig veröffentlicht wurden: eine Sammlung von Canzoni villanesche alla napolitana (1573) und zwei Sammlungen von Madrigali a cinque voci (1573 und 1582). Diese Veröffentlichungen sind die einzigen Quellen, die uns zur Verfügung stehen, um seine Biografie zu erforschen. Aus den Kopfzeilen der beiden Madrigalbücher erfahren wir, dass er – vermutlich ununterbrochen über einen Zeitraum von neun Jahren – Maestro di Cappella an der Kathedrale von Lecce war; das Vorwort und die Autorenliste des Villanellenbuchs hingegen führen uns in das dichte Beziehungsgeflecht des Baseo mit dem Adel von Lecce ein: von Mettola bis Guidani, von Mareschallo bis Santo Pietro del Negro. Geboren in einer Familie wahrscheinlich venezianischer Herkunft (Baseo: von Baxejo, Basegio, Baseggio), war Francesco Baseo nicht nur ein Künstler, der tief in das soziokulturelle Gefüge der Stadt Lecce integriert war, sondern auch ein Lehrer für einige Vertreter der nächsten Generation von Musikern des Salento. Die beiden Veröffentlichungen von 1573 zeigen, dass er die repräsentativsten Kompositionen eines bestimmten geografischen Kontextes sammeln wollte: Die Villanellen-Sammlung bietet einen Querschnitt der repräsentativsten Komponisten von Lecce, während das Madrigalbuch eine Auswahl der wichtigsten Komponisten präsentiert, die in jenen Jahren zwischen Rom und Neapel tätig waren. So finden sich darin Unikate von Ortiz, Da Nola, De Monte und Roy, sowie eine kostbare, unveröffentlichte Version von Palestrinas Io son ferito ahi lasso, die im Mittelpunkt des Konzerts steht. Die Veröffentlichung von 1582 – aus der die heute Abend aufgeführten Madrigale stammen – verlieh Baseo endgültig die Weihe als Komponist: Neunzehn der einundzwanzig Madrigale in der Sammlung sind seine eigenen Kompositionen. Die Sammlung, gewidmet Ferrante Caracciolo, dem Gouverneur der Provinzen Otranto und Bari, basiert auf weitgehend anonymen Texten (vielleicht von Baseo selbst verfasst) und in einigen Fällen auf Werken von Francesco Petrarca (Madrigale III, IV und V) und Ludovico Ariosto (XIX). Der kompositorische Stil ist raffiniert und solide: Die homorhythmische Schreibweise – verwendet in den Incipits und in einigen Abschnitten, in denen der Text eine «chorische» Betonung erfordert (Madrigal I und IV) – lässt Raum für einen straffen Kontrapunkt (Madrigal V und XII) und baut mit grosser Ausgewogenheit auf den verschiedenen Textepisoden auf (Madrigal XIII); nicht selten überrascht der Komponist mit harmonischen Lösungen von hervorragender Qualität (che gran tempo brami in Madrigal II, tal io misero son in Madrigal XI, la speranza morta in Madrigal XIX). Es ist schwierig, mit Sicherheit zu sagen, woher eine solche kompositorische Meisterschaft stammt, vor allem in Ermangelung einer angemessenen Dokumentation. Offensichtlich ist jedoch, dass Baseos Kompositionen ähnliche Züge aufweisen wie andere apulische Komponisten derselben Generation (Primavera, Felis, Effrem), die zwischen den 1650er und 1670er Jahren in neapolitanischen Musikkreisen verkehrten, zur gleichen Zeit, als Neapel – in enger Synergie mit Rom – die Heimat von Komponisten des Kalibers von Philippe De Monte, Orlando di Lasso und Diego Ortiz war. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass auch Baseo selbst diese Komponisten direkt aufgesucht hat. Dies würde erklären, warum er über unveröffentlichte Manuskripte von Ortiz, Da Nola, Roy, Palestrina und De Monte verfügte. Die Möglichkeiten, Licht in die Geschichte dieses Komponisten zu bringen, scheinen vielfältig zu sein, aber es ist sicher, dass die unerwartete Qualität seines Werks einen neuen Impuls im Mare magnum der Dokumente auslöst, um in der Gegenwart eine lebendige Erinnerung an diese fruchtbare Vergangenheit zu schaffen.
Gilberto Scordari> Programm als pdf
> Plakat als pdf
Schola Cantorum Barensis
Die Schola Cantorum Barensis ist ein Gesangs- und Instrumental-Ensemble spezialisiert auf das musikalische Repertoire des 16. und 18. Jahrhunderts. Gegründet und geleitet von Gilberto Scordari, die Schola präsentiert sich seit seiner Gründung als Ort der Begegnung zwischen Musiker aus Apulien und Artisten aus anderen Teilen des europäischen Kontinents; Debüt in Bari im Dezember 2018 mit der Eröffnung des Barion Festival (Bari) mit einem Programm zur deutschen Adventsmusik des 17. und 18. Jahrhunderts (Bach, Bruhns, Schütz, Praetorius). Die besondere Aufmerksamkeit für die Wiederherstellung und Aufwertung des unveröffentlichtes Repertoires der apulischen Schule hat das Ensemble dazu gebracht, seine erste CD-Aufnahme zu widmen – das 2021 für das Label DA VINCI und Gegenstand dieses Konzerts veröffentlicht wurde – an Francesco Antonio BASEO. Im November 2022 erschien, ebenfalls für DA VINCI, die Aufnahme der Mottetti von Giulio San Pietro DEL NEGRO (ca.1565–1620), einem Schüler von Baseo der aktiv in Mailand und Pavia war.
Mittwoch 22. März 2023
Wildt’sches Haus, Basel
20 Uhr
Come Farfalla
Unbekannte Madrigale aus Apulien (1582)
Werke von Baseo und Palestrina
Schola Cantorum Barensis
Cristina Fanelli – Cantus
Matteo Pigato – Altus
Roberto Rilievi – Quintus
Riccardo Pisani – Tenor
Michele Dispoto – Bassus
Gilberto Scordari – Leitung
Programm
Francesco Antonio BASEO (fl. 1573–1582)
I. Quercia superba e lieta (prima parte)
II. Da’ tuoi dorati rami (seconda parte)
III. L’arme tue furon gl’occhi (prima parte)
IV. L’angelica sembianza (seconda parte)
V. Fuggi ‘l sereno e ‘l verde
XIX. Se ben non veggon gl’occhi
Giannetto da PALESTRINA (1525–1594)
Io son ferito ahi lasso
Version aus F.A. Baseo, Primo libro (1573)
Francesco Antonio BASEO
XI. Come farfalla (prima parte)
XII. E d’appressarmi tremo (seconda parte)
XIII. Forz’è ch’io trovi (prima parte)
XIV. Muse beate (seconda parte)
XX. Se mai colpo d’amor
XXI. Basciami vita mia
Zum Programm
Die unbekannte Gestalt des aus Lecce stammenden Komponisten Francesco Antonio Baseo steht im Mittelpunkt einer Epoche – der letzten dreissig Jahre des 16. Jahrhunderts –, die in dem südöstlichen Teil des Königreichs Neapel, der Terra d›Otranto, von grossem kulturellen Eifer geprägt war. Von Baseo sind drei Sammlungen im Druck überliefert, die alle in Venedig veröffentlicht wurden: eine Sammlung von Canzoni villanesche alla napolitana (1573) und zwei Sammlungen von Madrigali a cinque voci (1573 und 1582). Diese Veröffentlichungen sind die einzigen Quellen, die uns zur Verfügung stehen, um seine Biografie zu erforschen. Aus den Kopfzeilen der beiden Madrigalbücher erfahren wir, dass er – vermutlich ununterbrochen über einen Zeitraum von neun Jahren – Maestro di Cappella an der Kathedrale von Lecce war; das Vorwort und die Autorenliste des Villanellenbuchs hingegen führen uns in das dichte Beziehungsgeflecht des Baseo mit dem Adel von Lecce ein: von Mettola bis Guidani, von Mareschallo bis Santo Pietro del Negro. Geboren in einer Familie wahrscheinlich venezianischer Herkunft (Baseo: von Baxejo, Basegio, Baseggio), war Francesco Baseo nicht nur ein Künstler, der tief in das soziokulturelle Gefüge der Stadt Lecce integriert war, sondern auch ein Lehrer für einige Vertreter der nächsten Generation von Musikern des Salento. Die beiden Veröffentlichungen von 1573 zeigen, dass er die repräsentativsten Kompositionen eines bestimmten geografischen Kontextes sammeln wollte: Die Villanellen-Sammlung bietet einen Querschnitt der repräsentativsten Komponisten von Lecce, während das Madrigalbuch eine Auswahl der wichtigsten Komponisten präsentiert, die in jenen Jahren zwischen Rom und Neapel tätig waren. So finden sich darin Unikate von Ortiz, Da Nola, De Monte und Roy, sowie eine kostbare, unveröffentlichte Version von Palestrinas Io son ferito ahi lasso, die im Mittelpunkt des Konzerts steht. Die Veröffentlichung von 1582 – aus der die heute Abend aufgeführten Madrigale stammen – verlieh Baseo endgültig die Weihe als Komponist: Neunzehn der einundzwanzig Madrigale in der Sammlung sind seine eigenen Kompositionen. Die Sammlung, gewidmet Ferrante Caracciolo, dem Gouverneur der Provinzen Otranto und Bari, basiert auf weitgehend anonymen Texten (vielleicht von Baseo selbst verfasst) und in einigen Fällen auf Werken von Francesco Petrarca (Madrigale III, IV und V) und Ludovico Ariosto (XIX). Der kompositorische Stil ist raffiniert und solide: Die homorhythmische Schreibweise – verwendet in den Incipits und in einigen Abschnitten, in denen der Text eine «chorische» Betonung erfordert (Madrigal I und IV) – lässt Raum für einen straffen Kontrapunkt (Madrigal V und XII) und baut mit grosser Ausgewogenheit auf den verschiedenen Textepisoden auf (Madrigal XIII); nicht selten überrascht der Komponist mit harmonischen Lösungen von hervorragender Qualität (che gran tempo brami in Madrigal II, tal io misero son in Madrigal XI, la speranza morta in Madrigal XIX). Es ist schwierig, mit Sicherheit zu sagen, woher eine solche kompositorische Meisterschaft stammt, vor allem in Ermangelung einer angemessenen Dokumentation. Offensichtlich ist jedoch, dass Baseos Kompositionen ähnliche Züge aufweisen wie andere apulische Komponisten derselben Generation (Primavera, Felis, Effrem), die zwischen den 1650er und 1670er Jahren in neapolitanischen Musikkreisen verkehrten, zur gleichen Zeit, als Neapel – in enger Synergie mit Rom – die Heimat von Komponisten des Kalibers von Philippe De Monte, Orlando di Lasso und Diego Ortiz war. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass auch Baseo selbst diese Komponisten direkt aufgesucht hat. Dies würde erklären, warum er über unveröffentlichte Manuskripte von Ortiz, Da Nola, Roy, Palestrina und De Monte verfügte. Die Möglichkeiten, Licht in die Geschichte dieses Komponisten zu bringen, scheinen vielfältig zu sein, aber es ist sicher, dass die unerwartete Qualität seines Werks einen neuen Impuls im Mare magnum der Dokumente auslöst, um in der Gegenwart eine lebendige Erinnerung an diese fruchtbare Vergangenheit zu schaffen.
Gilberto Scordari> Programm als pdf
> Plakat als pdf
Schola Cantorum Barensis
Die Schola Cantorum Barensis ist ein Gesangs- und Instrumental-Ensemble spezialisiert auf das musikalische Repertoire des 16. und 18. Jahrhunderts. Gegründet und geleitet von Gilberto Scordari, die Schola präsentiert sich seit seiner Gründung als Ort der Begegnung zwischen Musiker aus Apulien und Artisten aus anderen Teilen des europäischen Kontinents; Debüt in Bari im Dezember 2018 mit der Eröffnung des Barion Festival (Bari) mit einem Programm zur deutschen Adventsmusik des 17. und 18. Jahrhunderts (Bach, Bruhns, Schütz, Praetorius). Die besondere Aufmerksamkeit für die Wiederherstellung und Aufwertung des unveröffentlichtes Repertoires der apulischen Schule hat das Ensemble dazu gebracht, seine erste CD-Aufnahme zu widmen – das 2021 für das Label DA VINCI und Gegenstand dieses Konzerts veröffentlicht wurde – an Francesco Antonio BASEO. Im November 2022 erschien, ebenfalls für DA VINCI, die Aufnahme der Mottetti von Giulio San Pietro DEL NEGRO (ca.1565–1620), einem Schüler von Baseo der aktiv in Mailand und Pavia war.
Das waren die Konzerte des Jahres 2022.
|
K O N Z E R T 4
Wildt’sches Haus Mittwoch, 23. November 2022 20 Uhr Galanter Blumenstrauss – Musikalische Blüten vom Berliner Hof Ensemble Flor Galante Friedrich der Grosse gilt als glühender Liebhaber der Künste, insbesondere der Musik. Obwohl ihm sein strenger Vater, Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., das Flöte spielen und andere künstlerische Betätigungen zu verbieten versuchte, scharte der junge Friedrich bereits als Kronprinz erlesene Musiker um sich. 1736 übersiedelte er mit einer 17-köpfigen Kapelle von Ruppin nach Rheinsberg und verbrachte dort auf seinem Musenhof die «glücklichsten Jahre seines Lebens». Mit der Thronbesteigung 1740 nahm Friedrich die Rheinsberger Hofkapelle mit nach Berlin und erweiterte sie königlich. Die Musik erfüllte ihm einerseits repräsentative Zwecke. Anderes spielte sich im Privaten ab – in kleinen kammermusikalischen Kreisen, wo sich der König unter Gleichgesinnten der geliebten Traversflöte widmen konnte. Kein Wunder, dass er sich dafür einige der besten Interpreten seiner Zeit an den Hof geholt hatte, die ihm teilweise bis an ihr Lebensende treu blieben. |
K O N Z E R T 3
Wildt’sches Haus Mittwoch, 28. September 2022, 20 Uhr A Bird Fancyer’s Delight Ensemble Sonorità Werke von Uccellini, Monteverdi, Purcell, Hotteterre, Williams u.A. Mit zwitschernder Instrumentalmusik aus dem 16. und 17. Jahrhundert lädt Ensemble Sonorità ein zu „A Bird Fancyer’s Delight“. Ausgehend vom gleichnamigen kleinen Flageolett Traktat aus dem 17. Jahrhundert, hat das junge Ensemble Triosonaten und Solostücke aus England, Frankreich und Italien zu einem vom Vogelgesang inspirierten Programm zusammengestellt. Es erklingen Werke mit einem eindeutig lautmalerischen Bezug, aber auch Adaptionen von Vokalmusik, die sich im abstrakten Sinne mit der Figur des Vogels befassen. In Grounds und eigenen kleinen Improvisationen können Sie die Spielfreude des Ensembles erleben, das, dem Namen Sonorità nach, stets mit einer Fülle von Klangfarben experimentiert. |
K O N Z E R T 2
Galeriesaal Volkshaus, Basel Mittwoch, 22. Juni 2022, 20 Uhr Johann Sebastian Bach Goldberg-Variationen Diego Ares Die Goldberg-Variationen gelten als Klassiker der Cembaloliteratur und sind Gegenstand der gelehrtesten und raffiniertesten Studien und Analysen. Das Werk bietet sich dafür an, denn egal, wie man es betrachtet, die numerischen Proportionen und Intervallbeziehungen der neun Kanons, die es enthält, gehören zu den bewundernswertesten, die man in der Geschichte der Tastenmusik finden kann. Aber sicherlich gibt es in ihnen etwas, das viel wichtiger und transzendenter ist als die Zahl, das ewiger ist als ihre Architektur. Im Laufe der Jahre hatte ich Gelegenheit, die unterschiedlichsten Menschen zu treffen, die mir ihre Erfahrungen mit den Variationen anvertraut haben. Ein mallorquinischer Maler gestand mir einmal, dass das Hören dieses Werks ihm half, das Licht in seinen Bildern zu finden. Ich erinnere mich auch an eine Frau, die mir erzählte, dass sie dank der Goldberg-Variationen Trost und Hoffnung finden konnte. Und was ist mit der (ebenso umstrittenen wie symptomatischen) Legende des unglücklichen Grafen Kayserling, der seine langen schlaflosen Nächte durch das Hören der Goldberg-Variationen erleichterte! |
K O N Z E R T 1
Wildt’sches Haus, Basel Dienstag, 5. April 2022, 20 Uhr Cantar alla viola Giovanna Baviera– Gambe und Stimme Cantar alla viola – die Begleitung des eigenen Gesangs auf der Viola da Gamba – galt als eine der exquisitesten künstlerischen Praktiken der Renaissancekultur. In seinem Buch Il libro del Cortegiano (1528) lobt Baldassare Castiglione die Kunst der Selbstbegleitung. Durch die Konzentration auf einen einzelnen Musiker und seine Gesangsstimme kann eine Klarheit und Unmittelbarkeit des musikalischen Ausdrucks erlebt werden, die sich von der eines grösseren Ensembles völlig unterscheidet. Das Programm ist eine Hommage an diese Kunst. Die im Programm aufgeführten Werke sind grösstenteils Intabulierungen oder Umarbeitungen von Stücken, die nicht speziell für Gambe und Gesang geschrieben wurden. |
Blicken Sie nochmals zurück auf die Festtage 2021.